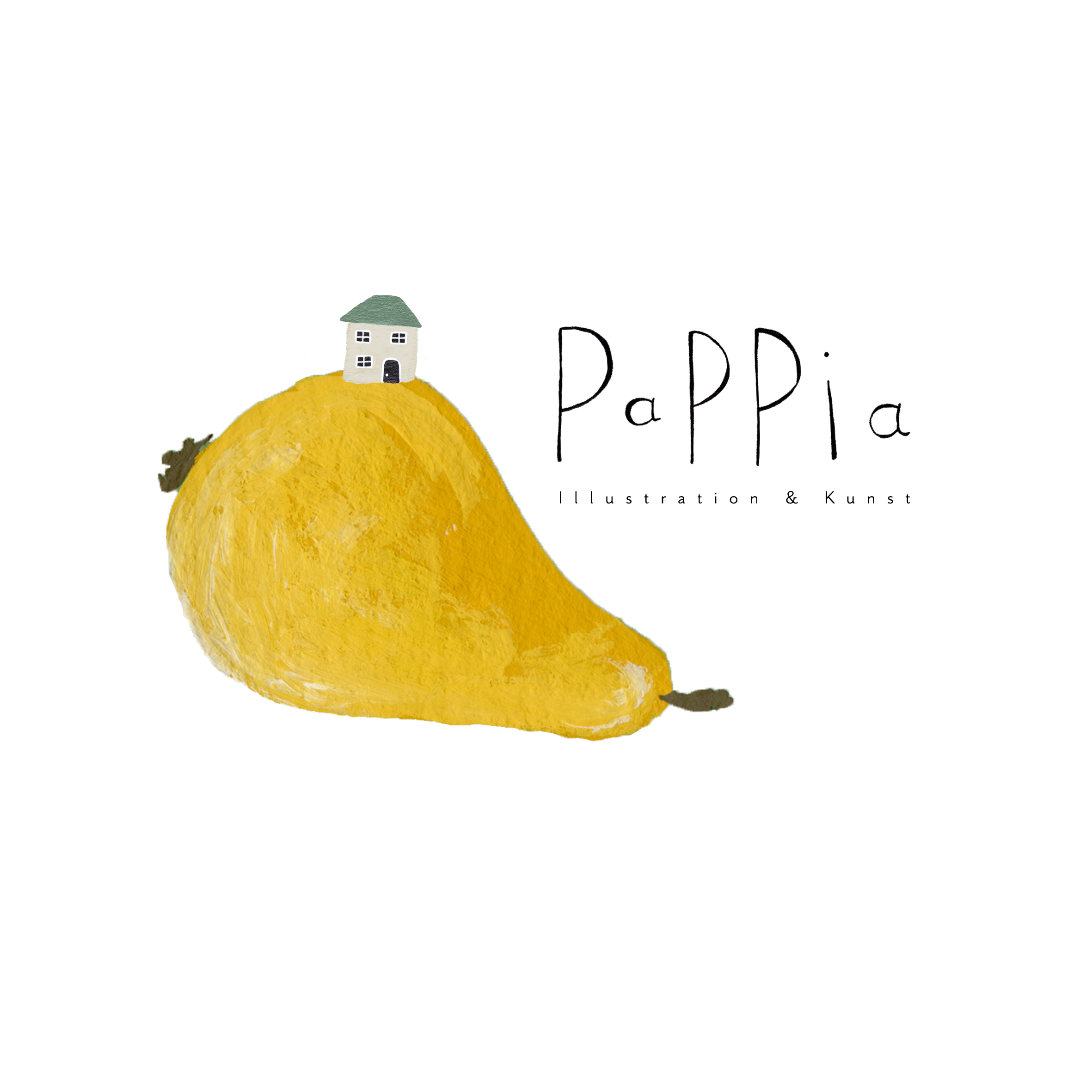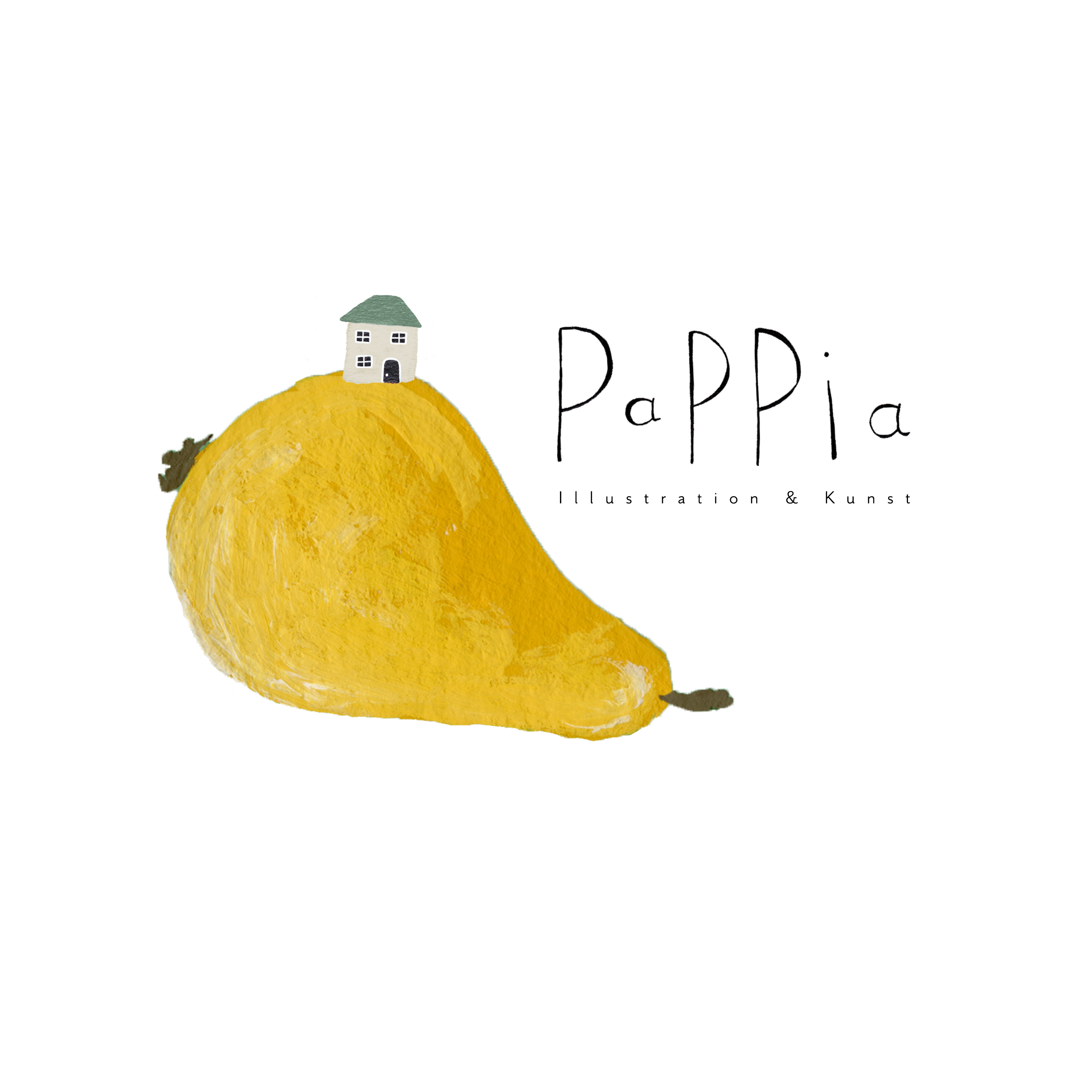Der richtige Glanz
Eine Erzählung.

Es war still im Raum. Es war der erste Advent. Die wenigen Menschen, die verstreut an den Tischen saßen, schauten mit müden Augen zu uns auf die Bühne, so müde, als hätte unser Gesang sie statt in eine festliche, in eine komatöse Stimmung versetzt. Die Stille wurde bloß von unregelmäßigem Papiergeraschel unterbrochen.
In diesem Raum gab es viel Papier, das rascheln konnte. Die roten Papiertischdecken, die dazu passenden Papierservietten mit Rentiermuster, die Notenheftchen auf den Tischen zum Mitsingen, die Papierkronen auf unseren Köpfen, die dekorativ gemeinten Papierstreifen an unseren Kerzen, die wir während unseres Auftritts in den Händen hielten.
Die Deckenbeleuchtung im Raum war nicht ausgeschaltet, sodass der Schein unserer Kerzen im Nichts verloren ging und eine festliche Atmosphäre ausblieb. Das billig lasierte Holz der Möbel schien den größten Glanz auszumachen.
Ich fragte mich, ob vielleicht gar nicht unser Gesang die Alten müde machte, sondern ob es die Weihnachtszeit war, die versuchte sich hier im Altenheim einen Platz zu suchen. Vielleicht bemerkten sie in dieser Zeit den zu seltenen Besuch von den Liebsten umso mehr. Vielleicht spürten sie die Abwesenheit von schon Gegangenen schmerzlicher. Vielleicht wirkten diese sterilen Räumlichkeiten mit den glänzenden Möbeln umso stiller. Ja, vielleicht war das so. Neben mir trällerte meine Freundin in schiefen Tönen „Oh Tannenbaum“. Vielleicht war unser Gesang doch nicht ganz unschuldig an der Müdigkeit.
Als wir fertig war, legte sich die Stille wie eine schwere Daunendecke über den Raum. Ein Hüsteln hier, ein Schnäuzen dort. Aber dann stand plötzlich eine alte Frau auf. Ihr Haar war dünn, sie trug leicht verwischten roten Lippenstift und hatte einen bunt gemusterten Schal um die Schultern gelegt. Leise, aber mit einer gekonnten Klarheit stimmte sie einen Ton an und begann „Stille Nacht, heilige Nacht“ zu singen. Alle starrten sie an. Meine Papierkrone rutschte mir vor Überraschung über die Augen. Dann stand ein Mann mit grauer Halbglatze und Morgenmantel auf, setzte sich an das Klavier, das am Rand der Bühne stand und begleitete die Frau mit zittrigen, aber geübten Fingern. Nacheinander stimmten die Alten mit ein. Wir konnten hören, dass viele von ihnen sicher einmal in einem Kirchenchor gesungen hatten. Ihre Stimmen waren so sicher, als hätten sie diesen Auftritt seit Monaten geübt. Ich ging zum Lichtschalter und schaltete das Licht aus. Der Glanz der Möbel machte Platz für unseren Kerzenschein. Ja, vielleicht machte die Weihnachtszeit die Alten müde. Ja, vielleicht auch einsam. Und ja, gewiss nostalgisch. Aber trotzdem ließen sie es sich nicht nehmen, ihr eigenes Fest daraus zu machen, dem wir Kinder bloß mit leicht geöffneten Mündern und großen Augen lauschen konnte.